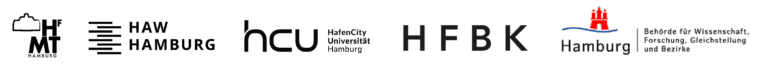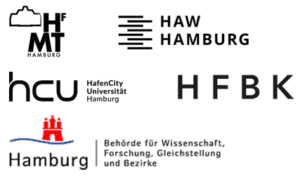Transfer
Wie lassen sich Aspekte von Transfer, Verbund und Kollaboration konzeptionell und methodisch denken, ohne lediglich in Allgemeinplätze zu verfallen? Was heißt Kooperation in der akademischen Welt heute, welchen Zweck kann sie dienen? Und wie begreift dies ARTILACS?
Forschen im Verbund
Für ARTILACS sind Wissenstransfer, Forschen im Verbund und kollaborative Teilhabe wichtige Themen, die sich als unmittelbar mit Verfahrensweisen Künstlerischer Forschung verbunden erweisen. Künstlerisches Wissen wird zum einen in kollektiven Zusammenhängen geteilt und erarbeitet. Zum anderen verweist es auf bestimmte disziplinäre Aufteilungen und verlangt nach Begrenzung und Konzentration. Wir bewegen uns daher in unserem Graduiertenkolleg stets an und mit einer Schnittstelle. Auf der einen Seite wollen wir exzellente Promotionsprojekte fördern, die sich auch in einem ganz klar fachlich definierten und umrissenen Kontext bewähren können. Auf der anderen Seite wollen wir Wissens-Gefüge miteinander vernetzen und auf diese Weise methodische Möglichkeiten für eine innovative Form Künstlerischer Forschung entwickeln.
Wir müssen also im Rahmen einer Doppel- bzw. Pendelbewegung vorgehen. Auf der einen Seite ist die klare Konzentration und der Fokus auf den Bezugsrahmen der jeweiligen Fachdisziplin maßgeblich. »Everything is everything«, insbesondere in der Künstlerischen Forschung – und allzu viel Beziehungsreichtum birgt die Gefahr, sich epistemisch zu verzetteln. Auf der anderen Seite fordert eine sich auch in politischer Hinsicht sehr dynamisch verändernde Wirklichkeit Wissenschaft und Künste heraus, sich in übergreifenden Kontexten, in kollaborativen Zusammenschlüssen und transdisziplinären Netzwerken zu verbinden. Nur auf diese Weise kann ein wichtiger Wissenstransfer zurück in die Gesellschaft gespielt werden, der aus den jeweiligen Fachdiskursen so etwas wie eine ›Summa‹, einen Querschnitt oder auch praktikablen Mittelwert gewinnt, der für viele und auch wissensferne Gruppen zugänglich wird.
Die Entscheidung für Teilhabe, Partizipation, gemeinschaftliches Denken ist bei ARTILACS daher kein Lippenbekenntnis. Es folgt vielmehr einem kalkulierten epistemischen Ziel: Nur im Verbund, nur durch die Resonanz mit anderen Sichtweisen können wir die jeweils eigene fachliche Perspektive schärfen und mit übergeordneten Problemlagen und Herausforderungen in Beziehung setzen.
Der Verbund, in dem wir forschen, ist daher ebenfalls in einem gewissen Sinne so etwas wie ein »latenter Raum«. Seine Potentiale sind teilweise (noch) unbekannt und es gilt, die in ihm schlummernden Möglichkeiten zu realisieren. Auch darin könnte ein ›Transfer‹ liegen, das heißt das (Her-)Übertragen von Wissensstrukturen in andere Kontexte und Medialitäten, die auf diese Weise eine neue Relevanz und übergeordnete Gültigkeit erfahren.
Kollektive Autor:innenschaft
ARTILACS begreift KI vor allem auch als eine kollektive Autor:in – einen Zusammenschluss von Daten, Meinungen und Zufällen, der klassische Begriffe von Autor:innenschaft anfragt und konterkariert. Wer ist es eigentlich, der schreibt beziehungsweise ›was‹ schreibt (sich), wenn KI schreibt? Wer schrieb, als Platon, Jane Austen, Friedrich Nietzsche etwas zu Papier brachten? Ist KI vielleicht nach Newton, Freud und dem Klimawandel die nächste fundamentale Kränkung der Menschheit, weil sie zeigt, dass ihre Sinnproduktion nicht durch sie selbst gesteuert werden kann? Verweist KI auf ein radikales Außen des Sinns, das wir durch vorab geregelte Zuschreibungen in der Regel beruhigen?
Wie auch unser Verbundprojekt zeigt sich KI als hybride Konstellation aus Einzelartikulationen und sinnhaftem Gruppengeschehen, das sich nur im Plural und von vorneherein als paradox verfasst interpretieren lässt. Wir können also auch in dieser Hinsicht viel von KI lernen, weil sie die uns als selbstverständlich zugetragenen Schreibweisen und Techniken der Sinnproduktion als brüchig erscheinen lässt. Vielleicht ist die Idee eines ›Autors‹, das heißt eines ›Urhebers‹, der einen abgrenzbaren Sinn in seine erfahrbare Gestalt versetzte, nur der Versuch, diese ursprüngliche und kollektive Unruhe des Sinns zu beruhigen oder gar zum Schweigen zu bringen. In diesem Sinn – beispielsweise – begreifen wir KI – ausgehend von künstlerischer Praxis mit ihr und vermittelt durch diese – kritisch-affirmativ. Wir trauen ihr zu, unsere sinnhaften Routinen und fertigen Sichtweisen auf die Welt in Bewegung zu versetzen und als selbstverständlich deklarierte Übereinkünfte der Sinnproduktion zu diversifizieren. KI macht Sinn, allerdings in einer anderen Weise, als es der gesunde Menschenverstand erwartet hatte.
Artistic Intelligence in Latent Creative Spaces
Künstlerische Intelligenz wird immer dann virulent, wenn die Ressourcen knapp werden. Ein Stift, ein Blatt Papier, etwas Tusche… Und fertig ist ein kleines Kunstwerk, das die ganze Welt umfasst. Die akkumulativen Systeme, die Sinnproduktion und Kapitalvermehrung beanspruchen, wirken gelegentlich etwas ›lahm‹. Sie vermögen in ihrer Gefräßigkeit häufig nur eine erdrückende, nicht aber jubelnde Fülle zu produzieren. Für die methodische Erforschung künstlerischer Wissensformationen hat diese Erkenntnis eine erhebliche Konsequenz. Denn auch Methoden können ›hinken‹… Legen sie sich von Anfang an zu sehr fest, dann verlangsamen sie die Bewegung eines Denkens.